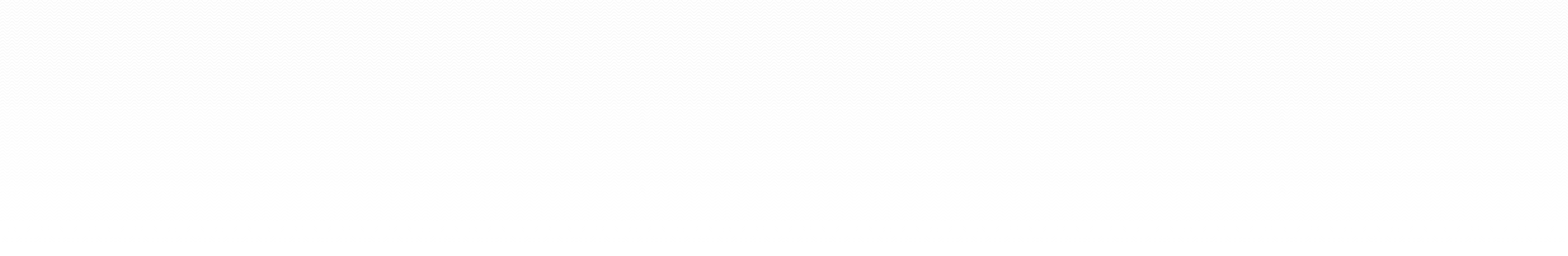Zwangsarbeit in Oberursel während des Zweiten Weltkriegs
Mit dem Kriegsende begann für Millionen ehemaliger deutscher Soldaten die Leidenszeit der Kriegsgefangenschaft. Von denen, die das Unglück hatten, in eines der russischen, französischen und auch amerikanischen Hungerlager zu geraten, kehrten viele nicht mehr heim. Von denen, die Zwangsarbeit bei Bauern und in Kleinbetrieben leisten mussten, sind viele Freunde ihrer unfreiwilligen Gastgeber geworden. Der Urgrund unserer Aussöhnung mit Frankreich wurde mit der freundlichen Behandlung deutscher Kriegsgefangener durch solche Familien gelegt.
Nicht anders ging es den Zwangsarbeitern aus Frankreich, Polen, Belgien, Holland, Kroatien, Ungarn, der Ukraine, den baltischen Staaten und Russland, die zwischen 1939 und 1945 nach Oberursel, Oberstedten, Stierstadt und Weißkirchen verschleppt worden waren. Es sollen mehr als siebenhundert gewesen sein. Allein in Oberursel gab es sieben Lager oder Gemeinschaftsunterkünfte für die „Fremdarbeiter“. Sie wurden vergleichsweise gut behandelt. Es gab zwar das „Fraternisierungsverbot“ der Deutschen mit den Fremden. Aber das galt zumindest in den bäuerlichen Familien und Haushalten, in die es viele der Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter verschlug, nicht viel. Man aß über kurz oder lang trotz Verbots gemeinsam am Tisch; die Fremden lernten Deutsch, freundeten sich gegen alle Verbote mit Deutschen und untereinander an, auch mit dem jeweils anderen Geschlecht, was später zu Eheschließungen führte. Viele blieben einfach hier, weil sie wussten, dass sie in der Heimat nicht mehr willkommen waren. Wir wissen heute, dass heimkehrende Fremdarbeiter und Kriegsgefangene von Stalins Schergen schikaniert und viele in neue Gefangenschaft und Verbannung weitergeschickt wurden.
Die Zwangsarbeiter arbeiteten in Fabriken – etwa der Motorenfabrik, der Maschinenfabrik Turner, bei Faudi Feinbau und der Schuhmaschinenfabrik Adrian & Busch in Oberursel und der Ceresinfabrik in Weißkirchen, andere in der Landwirtschaft und als Haushaltshilfen. Sie wurden von den Nationalsozialisten als Untermenschen betrachtet, durften weder Wohnort noch Arbeitsstelle selbstständig wählen, sich nicht versammeln und organisieren, während der nächtlichen Sperrstunde ihre Unterkunft nicht verlassen; der Besuch deutscher Veranstaltungen, selbst von Gottesdiensten, und von Gaststätten war ihnen untersagt. Radioapparate und Zeitungen durften sie nicht besitzen. Sie waren dem direkten Zugriff der Sicherheitspolizei ausgesetzt.
Als der Krieg zu Ende war, hielt es die meisten nicht mehr lange im Taunus. Wer nicht heimkehren wollte, wurde von den amerikanischen Besatzungstruppen dazu gezwungen. Stanislaus Miszta, ein polnischer Kriegsgefangener, der 1939 mit 31 Jahren nach Oberursel gebracht worden war und den ich gut kannte, versteckte sich auf einem Bauernhof in der Eppsteiner Straße wochenlang im Kamin, um der Heimreise nach Polen zu entgehen. Dort wartete, wie ich erst viel später erfuhr, auf ihn nach erzwungener Heirat seine Gattin mit Sohn, den er noch nie gesehen hatte und offenbar auch nicht sehen wollte. Wir wunderten uns immer, dass Stanislaus keine Anstalten machte, in Oberursel zu heiraten, denn er blieb vierzig Jahre hier. Er übernahm den Bauernhof, auf dem er einst zwangsverpflichtet war, als Erbe vom kinderlosen Landwirt Josef Messerschmidt. Erst im Ruhestandsalter bequemte er sich, die Verhältnisse mit seiner polnischen Familie in Ordnung zu bringen; er ließ seinen Sohn kommen und beschenkte ihn reichlich, heiratete nach dem Tod seiner Frau seine ebenfalls verwitwete Schwägerin, verkaufte den Hof, siedelte in seine Heimat Myszkow bei Kattowitz über und starb dort im Juni 2000 umsorgt und hochbetagt im Alter von 92 Jahren.
Anderen ging es nicht so gut. Wie gesagt wurden viele im Heimatland nicht gerade herzlich empfangen, sondern wie Verräter behandelt. Wieder andere starben im Taunus und liegen bei uns begraben. Jedes dieser Gräber erzählt eine Geschichte.
Da ist Iwan Bogdan, der bei Adrian & Busch arbeiten musste und immer schwermütiger wurde. Eines Tages beim Entladen von Waggons auf dem Oberurseler Bahnhof stürzte er sich vor die Straßenbahn. Er wurde 33 Jahre alt.
Da ist der Pole Kasimir Trybotowski, der bei Karl Ruppel in der Ackergasse als Landarbeiter beschäftigt war und dann als Schäfer nach Bommersheim versetzt wurde. Im Feld fand er eine Panzerfaust, die wohl ein Soldat der sich auflösenden Wehrmacht weggeworfen hatte. Als er damit hantierte, ging sie los und verletzte ihn tödlich. Er liegt jetzt hier vor uns, gestorben am 29. März 1945, einen Tag vor seiner Befreiung. Er war erst dreiundzwanzig.
Da ist Jean Willems, ein belgischer Fremdarbeiter, 35 Jahre alt. Am 21. Februar 1945 aß er mit Arbeitern der Ceresinfabrik in Weißkirchen zu Mittag, als die Fabrik wie aus heiterem Himmel bombardiert wurde. Eine Bombe traf die Kantine. Willms und viele Arbeiter, freiwillige und unfreiwillige, kamen ums Leben. Willms erhielt ein Ehrengrab auf dem Weißkirchener Friedhof; andere wurden in ihre Heimat umgebettet.
Da ist Nadja Sorvucj, die Ukrainerin. Sie war achtzehn, als die Befreiung kam. Mit einer Gruppe von Ukrainern, die sich in der Volksschule von Stierstadt einquartiert hatten und bewaffnet waren, wurde sie zur Plünderin. Dabei stürzte sie mit dem Fahrrad und verletzte sich so schwer, dass sie am 27. Mai 1945 starb. Sie liegt auf dem Stierstädter Friedhof.
Die Oberurseler haben dafür gesorgt, dass die sterblichen Überreste der in Oberursel verstorbenen einstigen Zwangsarbeiter – getrennt von den deutschen gefallenen Soldaten – in Ehrengräber gebettet wurden, die uns heute als Mahnmal dienen. Die Gräber von Sorvucj und Willms sind – soweit wir wissen – die einzigen in den späteren neuen Stadtteilen Oberursels bis heute erhaltenen Zwangsarbeitergräber.
Quelle: Gedenkfeier des Vereins zur Förderung der Oberurseler Städtepartnerschaften e.V. am 30. März 2005, Oberursel, Alter Friedhof. Aus der Ansprache des Vorsitzenden, Dr. Christoph Müllerleile.